Pauschalen als ergänzende Vergütungsform
Mit der Bündelung von Leistungen zu einheitlich vergüteten Leistungspaketen stehen, im Gegensatz zur Einzelleistungsvergütung à la TARMED, alternative Tarifformen zur Verfügung. Der entscheidende Vorteil liegt in der damit geschaffenen Freiheit für behandelnde Ärztinnen und Ärzte.
Ambulante Fallpauschalen
Der Nutzen flächendeckender Pauschalen ist umstritten: nur Flickwerk oder die praktische Lösung akuter Probleme?
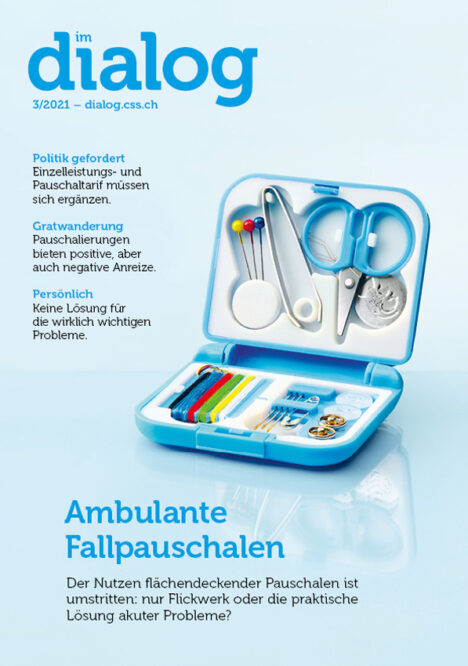
Im Rahmen des Leistungsumfangs der Pauschale werden die Patientinnen und Patienten individuell betreut. Die Ärzteschaft bewegt sich finanziell innerhalb der Vorgaben eines «Mini-Globalbudgets». Dieses beinhaltet zwar keine definierte Ausgaben- bzw. Kostenlimite, jedoch einen starken impliziten Sparanreiz. Aufgrund der fixen Vergütung sind medizinische Fachpersonen angehalten, keine unnötigen Leistungen zu veranlassen. Ärztinnen und Ärzte können bewusst die Details der Betreuung und Behandlung individuell anpassen, wohlwissend, dass manche Patientinnen und Patienten einen höheren, andere wiederum innerhalb der gleichen Pauschale einen niedrigeren Aufwand generieren.
Aspekte der Entwicklung von Pauschalen
Preis und Leistung müssen in einem vernünftigen, möglichst realistischen Verhältnis stehen. Dies gilt auch für den Wert definierter Leistungspakete untereinander. Aus Sicht der Tarifentwicklung sind deshalb Pauschalen so zu definieren, dass sie einem abgrenzbaren und reproduzierbaren Produkt entsprechen. Für die Abgrenzung sollten aktuelle Kostendaten aus dem jeweiligen Anbietermarkt (z. B. der ambulant tätigen Ärzteschaft bzw. medizinischen Einrichtungen) vorhanden sein. Im Gegensatz zum stationären Bereich kann heute noch nicht auf national anerkannte, einheitliche und allenfalls verpflichtende Instrumente der Leistungs- und Kostenerfassung (Kostenträgerrechnung und medizinische Statistiken) zurückgegriffen werden.
«Mit einer Pauschale wird den Leistungserbringern grundsätzlich mehr Budgetverantwortung übertragen.»
Simon Hölzer
Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz
Es wird sich zeigen, wie sich die Leistungserbringer auf diese Form der Abgeltung einstellen. Es besteht das Risiko, dass die Anwendung von Einzelleistungstarifen oder deren Verwendung als Berechnungsbasis von Pauschalen mit normativen Kostenmodellen falsche Preisstrukturen zementiert und weiterhin einseitige Anreize zur Mengenausweitung fördert. Pauschalen als alternative Vergütungsform können dazu ein Gegengewicht bilden, wenn es gelingt, das Zusammenspiel mit den weiteren Tarifen über klare Abrechnungsregeln und die sogenannte Falldefinition zu regeln. Mit der Falldefinition wird eindeutig festgelegt, welcher Tarif für welche Leistung bei welchen Patientinnen und Patienten angewendet wird.

Mit einer Pauschale wird den Leistungserbringern grundsätzlich mehr Budgetverantwortung übertragen, im Vertrauen, dass diese Geldmenge vernünftig eingesetzt wird. Im Idealfall sind sich Leistungserbringer bewusst, welche Kosten durch ihr Handeln ausgelöst werden. Dies gilt auch für allfällige Folgekosten, die z. B. durch angeordnete Massnahmen (stationäre Einweisung oder Facharztkonsultationen) entstehen. Voraussetzung für Pauschalen ist jedoch ein Mindestumfang an ärztlichen Qualifikationen, an Infrastrukturen und Leistungen in Kombination mit der Vorgabe von Behandlungszielen respektive des Patienten-Outcomes.
Weitere Knackpunkte
Nicht alle Leistungen lassen sich an einen konkreten, abrechenbaren Behandlungsfall knüpfen. Die Finanzierung von Reservekapazitäten oder Bereitschaftstätigkeit (Personal und Infrastruktur) ist in unserem System explizit vorgesehen.
Dies ist im ambulanten Bereich umso gravierender, da ähnlich definierte Leistungen in strukturell unterschiedlichen Einrichtungen erbracht werden und unterschiedliche Kostenstrukturen und «Qualitäten» aufweisen. So können gewisse Konsultationen telemedizinisch, beim Hausarzt in der Praxis oder in einem spezialisierten Ambulatorium eines Unispitals stattfinden.






