Haben wir zu viele Spitäler in der Schweiz?

Patrick Rohr (PR): Herr Cerny, Sie haben vor einigen Jahren in einem Interview gesagt: «Der Föderalismus behindert die Qualität und tötet Patienten.» Würden Sie diesen Satz heute noch so unterschreiben?
Thomas Cerny (TC): Die Formulierung ist hart, ja, aber es ist tatsächlich so, dass wir für Effizienz und Qualität nicht mehr kleinräumig arbeiten können. Für Qualität braucht es auch die entsprechende Quantität, und die lässt sich nur in einem grösseren Verbund herstellen. Wir müssen in «catching areas» von Millionen denken, nicht in Kantonen, die vielleicht nur gerade 20 000 Einwohner haben.
Das föderalistische Gesundheitssystem
Braucht es statt 26 kantonaler Gesundheitssysteme vermehrt Bestrebungen, die Versorgung regional oder gar gesamtschweizerisch zu betrachten?
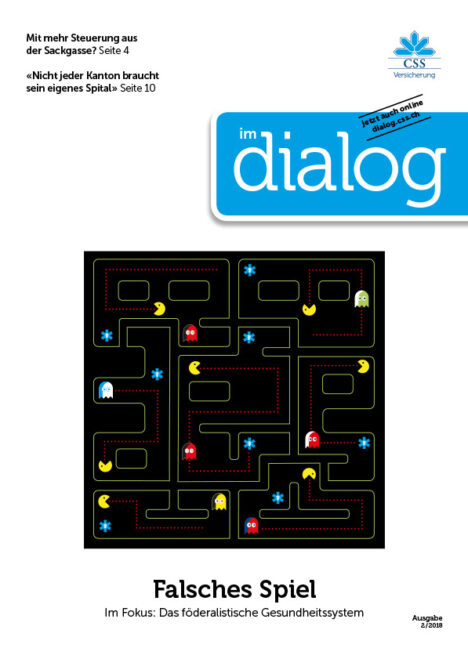
PR: Sie würden also kleineren Kantonen das Recht auf ein eigenes Spital absprechen?
TC: Es braucht Verbundlösungen, damit man eine kritische Grösse erreicht. Wir haben zu viele Spitäler, und wir müssen schauen, dass die Qualität dort, wo sie heute schon hoch ist, weiterentwickelt wird. Und dass wir dort, wo es Defizite gibt, bereit sind, auch strukturelle Massnahmen zu ergreifen. Spitalschliessungen dürfen kein Tabu sein. Wobei das nicht heissen muss, dass ein Spital verschwindet, es kann zum Beispiel zu einem Dienstleistungszentrum in einem Versorgungsnetzwerk werden.
PR: Herr Regierungsrat, was sagen Sie zu den Vorschlägen von Herrn Cerny?
Pierre Alain Schnegg (PAS): Nehmen wir den Kanton Bern mit der Region «Oberland». Eine Region, die flächenmässig grösser ist als der Kanton Zürich, in der aber nur gut 100 000 Menschen leben. Haben diese Leute kein Recht auf eine Versorgung? Natürlich müssen sie nicht alle Dienstleistungen zur Verfügung haben, aber eine gewisse Grundversorgung brauchen sie. Schliesst man in einer solchen Region das Spital, dann weiss man, dass es bald auch keine Hausärzte mehr gibt, und dann fehlt die Grundversorgung. Es gibt viele Angebote, die man konzentrieren kann und auch noch weiter konzentrieren soll, aber es braucht flächendeckend im ganzen Land eine gute Grundversorgung. Und die können wir nun einmal nicht auf einer anderen Ebene definieren als auf der Ebene der Kantone.
PR: Warum nicht? Braucht zum Beispiel der Kanton Uri tatsächlich auch ein eigenes Spital, würde nicht ein grosses in der Zentralschweiz reichen?
PAS: Ich kämpfe überhaupt nicht dafür, dass jeder Kanton sein eigenes Spital haben muss. Ich kann nur für den Kanton Bern sprechen und sage, dass wir hier flächendeckend eine gute Grundversorgung brauchen.
PR: Dann sind Sie mit Herrn Cerny also einig?
PAS: Wir liegen sicher nicht weit auseinander.

«Es braucht flächendeckend im ganzen Land eine gute Versorgung.»
Pierre Alain Schnegg
PR: Das werden Ihre Kollegen in der Gesundheitsdirektorenkonferenz, die kleinere Kantone vertreten, aber nicht gerne hören?
PAS: Herr Cerny und ich sind uns im Grundsatz einig, aber es gibt schon ein paar Unterschiede: Wenn wir auf einer anderen Ebene als auf der Ebene der Kantone eine Lösung suchen wollen, dann gibt es nur den Bund. Dazwischen gibt es nichts. Wenn jetzt zwei oder drei Kantone eine gemeinsame Spitalliste entwickeln wollen – gut! Aber wer behandelt dann eine Beschwerde, wer ist die erste, wer die zweite Instanz? So einfach ist das nicht. Aber es ist sicher sinnvoll, wenn die Kantone zusammen diskutieren.
PR: Das heisst, Ihre Idee mit den grösseren Verbünden funktioniert schon rein strukturell nicht, Herr Cerny?
TC: Schauen wir uns doch zum Beispiel einmal Greater London an, ein Gebiet, das einwohnermässig etwa so gross ist wie die Schweiz: Gut acht Millionen Menschen leben da, und es gibt 32 Spitäler. Ich bin kein Freund des National Health Service in England, aber trotzdem: In diesen 32 Spitälern bekommen Sie alles, was die Medizin bieten kann. Wir müssen uns die Frage stellen: Sind wir in der Schweiz schon so weit, dass das System für viele Menschen nicht mehr bezahlbar ist, oder können wir uns mit kleinen Anpassungen weiterbewegen? Wenn ich nur schon die Entwicklung der Altersdemografie anschaue, dann denke ich, dass wir uns dringend auf die Socken machen müssen. Unsere Politik ist sehr träge, und die Verantwortlichen denken in kleinen Räumen von drei, vielleicht vier Jahren. Ich bin nun schon fast 40 Jahre im Gesundheitswesen tätig, ich denke in grösseren Räumen, und ich muss Ihnen sagen: Wir sind in einer Situation, in der wir wirklich neu denken müssen.
PR: Also in Gesundheitsregionen statt Kantonen?
TC: Der Kanton Bern und der Kanton Zürich können von ihrer Grösse her problemlos eine Region bilden, aber wenn selbst ein Kanton, der halb so gross ist wie Köniz, ein eigenes Spital will – dann müssen wir dringend neu denken!
PAS: Das kann ich nur unterstützen. Wenn wir so weiterfahren wie bis jetzt, dann werden wir nie eine Dämpfung des Wachstums erreichen. Aber rein strukturelle Änderungen bringen keine Lösung, da braucht es andere Ansätze. Ein Hauptpunkt wäre für mich, dass wir endlich alle Daten, die es gibt, nutzen können; nicht mit zwei Jahren Verspätung, sondern laufend. Dann würde man sehen, wenn zum Beispiel die Zahl gewisser Eingriffe plötzlich unerklärlich wächst.
PR: Aber führt denn nicht gerade der Wettbewerb zwischen den Kantonen zu solchen Exzessen, Herr Schnegg? Weil jedes Spital ausgelastet sein will?
PAS: Ja, aber die Frage ist doch: Warum baut man überhaupt so viel? Das ist eine rein wirtschafts- und standortpolitische Entscheidung.
PR: Schauen wir es einmal so an, Herr Cerny: Volkswirtschaftlich haben die Spitäler eine grosse Bedeutung, sie sind wichtige Arbeitgeber – und entsprechen darüber hinaus einem Bedürfnis der Leute.
TC: Das kann man nicht wegdiskutieren, der Gesundheitsbereich ist der grösste Dienstleistungssektor in einer modernen Gesellschaft. Aber wenn ein Kanton über die Spitäler Beschäftigungspolitik macht und dann noch dieser oder jener Baufirma einen Auftrag zuschanzt, dann sollte er das deklarieren und einen grossen Teil der Investitionen selber übernehmen müssen – und das nicht auf die Prämienzahler abwälzen dürfen. Das passiert nämlich.

«Das Problem ist, dass im Moment jeder auf seinen Vorteil schaut.»
Thomas Cerny
PR: Es passiert ja auch noch etwas anderes: Die Kantone schauen, dass immer mehr Behandlungen ambulant ausgeführt werden, nicht mehr stationär, weil sie sich dann nicht an den Kosten beteiligen müssen.
PAS: Wir können gerne über ein neues Finanzierungssystem diskutieren, persönlich bin ich offen dafür. Aber ein neues Finanzierungssystem würde keinen Rappen sparen. Wenn Sie eine Rechnung von 100 Franken auf dem Tisch haben, spielt es doch keine Rolle, ob Sie diese Rechnung bezahlen oder Ihre Frau oder ob beide je 50 Franken zahlen. Am Schluss kostet es 100 Franken.
TC: Ich bin einverstanden, wenn man das rein finanzierungstechnisch anschaut. Aber das Problem ist doch, dass im Moment jeder auf seinen Vorteil schaut. Jeder wartet, wie beim Mikado, darauf, dass der andere das Stäbchen zuerst in die Hand nimmt und verliert.
PR: Dazu passt auch, dass die Einführung der Fallpauschalen vor sechs Jahren nicht die gewünschten Verbesserungen gebracht hat – keine Spur von grossen Einsparungen, nach wie vor viel Intransparenz.
PAS: Ich bin der Meinung, dass wir im Kanton Bern einen grossen Teil unserer Hausaufgaben gemacht haben. Ich denke, das Einzige, was zu fundamentalen Systemänderungen führen würde, wäre der Konkurs eines öffentlichen Spitals. Das würde aufschrecken.
PR: Damit sagen Sie aber, dass man tatsächlich zu viele Spitäler rein künstlich am Leben erhält?
PAS: Das Problem ist nicht die Zahl der Spitäler. Die Frage ist: Was offerieren wir in einer Institution? Es braucht nicht in jeder Region des Kantons Bern eine Herzchirurgie, so etwas kann man problemlos zentralisieren.
TC: Wichtig ist, den Zugang zu haben, der muss gerecht verteilt sein! Schauen wir doch mal nach Schweden. Ein gigantisches Land. Dort gehen Frauen für eine Spitalgeburt bis zu 800 Kilometer weit, notfalls mit dem Flugzeug.
PR: Möchten Sie so weit gehen, dass eine Frau aus dem Engadin vom Flugplatz Samedan nach Bern fliegen muss für eine Geburt?
TC: Das ist ein Extrembeispiel. Aber wenn wir auch in 20 Jahren noch gut fahren wollen, auch vor dem Hintergrund steigender Investitionskosten, dann müssen wir gewisse Dienstleistungen zentralisieren.
PR: Herr Schnegg, das Problem ist doch, dass jeder Politiker, der ein Spital schliessen will, politischen Selbstmord begeht?
PAS: Das kann die Denkweise von gewissen Gesundheitsdirektoren sein, das kann ich mir durchaus vorstellen.
PR: Aber auch Sie spüren zurzeit heftigen Gegenwind – aus dem Oberland, wo Sie das Spital in Zweisimmen nicht subventionieren möchten.
PAS: Das ist mir völlig egal! Ich würde lieber abgewählt werden, als einen falschen Entscheid zu fällen – wenn ich weiss, dass er falsch ist.
TC: Das freut mich zu hören!
PAS: Ich wusste, dass diese Entscheidung schlecht sein würde für meine Wiederwahl. Viele Leute haben mich gefragt: «Warum tust du das so kurz vor den Wahlen?» Aber das ist doch genau das Problem in der Politik: Man muss Entscheidungen immer aufgrund der Frage fällen, was die Bevölkerung braucht und was nicht.

PR: Würden alle Politiker so denken, dann wären alle Probleme gelöst, Herr Cerny?
TC: Ich bin überzeugt, dass immer mehr Leute sehen, dass sich Politiker, die sich so exponieren, echt für das Volk einsetzen. Ich bin überzeugt, Herr Schnegg, dass es Leute gibt, die Sie genau wegen dieser Entscheidung gewählt haben. Man kann die Leute mit guten Argumenten gewinnen, das Problem ist immer die Kommunikation. Wenn ein Spital in einer Region der grösste Arbeitgeber ist, dann muss man Alternativen aufzeigen können. Ein Entscheid muss gesamtpolitisch eingebettet sein, dann ziehen die Leute mit. Verena Diener hat als Gesundheitsdirektorin in Zürich Spitäler geschlossen und wurde wiedergewählt. Sie kam sogar in den Ständerat. Warum? Weil sie der Bevölkerung klarmachen konnte, dass das nicht der Tod für eine Region bedeutet, sondern dass es neue Bedürfnisse gibt – Spitex, Palliative Care – und dass es auch dafür Leute braucht.
PR: Einverstanden, Herr Schnegg?
PAS: Ich bin nicht so weit weg von dem, was Sie sagen, Herr Cerny. Wir müssen uns vorbereiten auf die Zukunft. Und vielleicht muss man sich tatsächlich irgendwann fragen, ob die 26 Kantone noch die richtige Organisationsstruktur sind. Wenn sie es für die Gesundheit nicht mehr sind, dann sind sie es aber auch auf anderen Gebieten nicht mehr: Ausbildung, Transport …
TC: Wie wollen wir in einer Welt mit einem gigantisch wachsenden Asien
mit unseren kleinräumigen Strukturen noch kompetitiv sein? Vielleicht funktioniert es noch auf der Ebene der Volksschule, aber danach?










